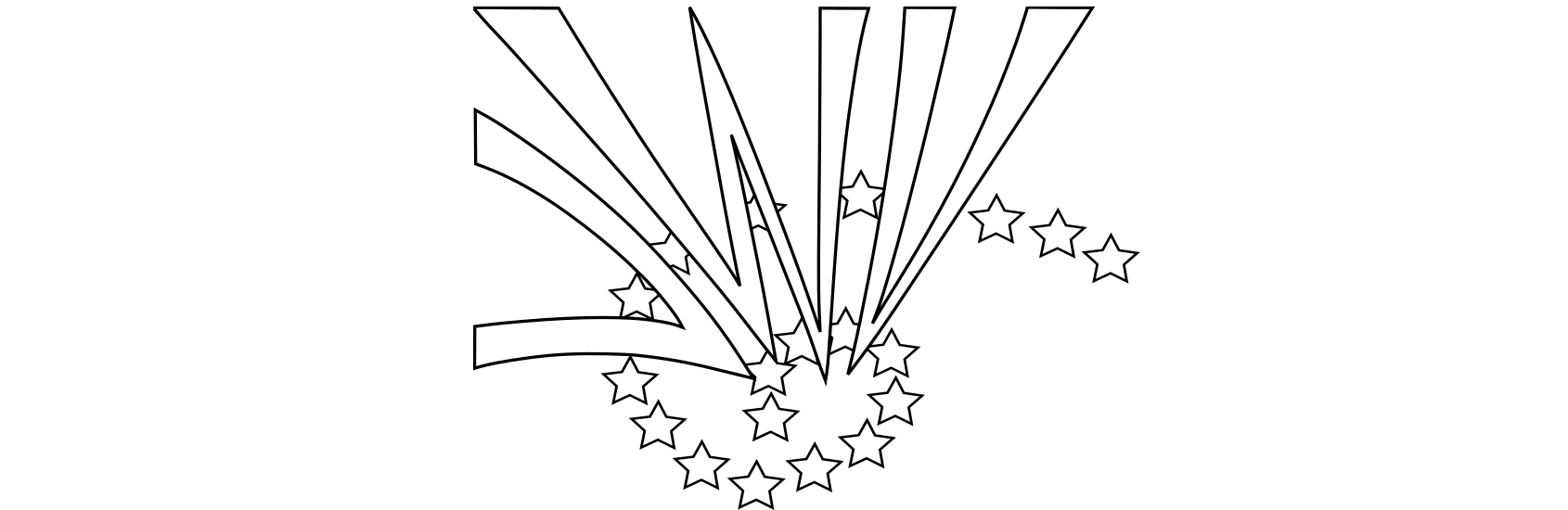BRAND – FUNDAMENT FÜR DAS LEBEN
Unter Kaiserin Maria Theresia wurde im Jahr 1774 die Unterrichtspflicht für Österreich und die unter habsburgerischer Herrschaft stehenden Länder eingeführt. Eine eigene Schule in Brand ist aber erst Ende des 18. Jahrhunderts auf mehrfaches Drängen des Kreisamtes errichtet worden. Es war eine einklassige Volksschule, wo die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernten. Der Pfarrer hatte die Pflicht, einmal wöchentlich in die Schule zu gehen und Christenlehre zu halten. Nach einer schriftlichen Aufzeichnung mussten die Schulkinder jeden Abend nach beendeter Schule ein „Vaterunser“ und ein „Ave- Maria“ beten.
Wie alt das erste Schulhaus ist und wann erstmals Unterricht gehalten wurde, ist nicht genau bekannt. Es dürfte das Jahr 1793 gewesen sein, als Chrysogonus Sugg als erster Lehrer von Rungelin nach Brand versetzt wurde. Der Posten eines Lehrers in einem abgelegenen und schwer erreichbaren Bergdorf war verständlicherweise nicht begehrt. So blieb die Stelle öfters unbesetzt, da kein Lehrer gefunden werden konnte. In diesen Fällen sprang immer wieder der Pfarrer ein und musste Unterricht erteilen. Franz Mäser, Pfarrer von 1827 bis 1843, schreibt in seiner Chronik:
„In Brand befindet sich nur eine Schule und zwar nächst der Pfarrkirche. Es ist nur ein Schulzimmer vorhanden. Im Winter 1833/34 besuchten 76 Kinder die Schule. Sie hält einen eigenen Lehrer, der zugleich auch Organist ist. Der Gottesdienst wird mit Orgel und Gesang gefeiert.“
Im Jahr 1884 kam Melchior Geser aus Andelsbuch als Pfarrer nach Brand. Er muss ein sehr fortschrittlicher Mann gewesen sein, denn auf seine Anregung hin wurde eine Sonntagsschule eingeführt. Den Unterricht hielten Pfarrer und Lehrer gemeinsam. Schulpflichtig waren alle ausgeschulten Mädchen und Burschen bis zum 18. Lebensjahr. Die Volksschule wurde bis zum Jahr 1912 einklassig geführt, wobei sich die Schülerzahlen zwischen 50 und 65 bewegten und das in nur einem Klassenzimmer.
Als im Schuljahr 1911/12 die Schülerzahl auf 75 anstieg, wurde die Schule erstmals zweiklassig geführt. Die erste Klasse mit 33 Schülern unterrichtete Elsa Muther und die zweite Klasse mit 42 Schülern der bisherige Lehrer Fidel Schallert. Die Einstellung und Entlohnung der zweiten Lehrkraft war Aufgabe der Gemeinde und musste vom Gemeindeausschuss jedes Jahr neu beschlossen werden. Während des Ersten Weltkrieges wurde der zweiklassige Schulbetrieb eingestellt, da keine zweite Lehrkraft zu finden war. Nach Kriegsende ist wieder eine zweite Lehrkraft beschäftigt und der Schulbetrieb zweiklassig geführt worden. Den Religionsunterricht erteilte der jeweilige Pfarrer. Ab dem Schuljahr 1972/73 gab es keine Oberstufe mehr, denn von da an durften in der Dorfschule von Brand nur noch Schüler von der 1. bis zur 4. Schulstufe unterrichtet werden. Die Volksschule wurde trotzdem – und das heute noch – zweiklassig weitergeführt.
Am 3. November 1924 fasste der Gemeindeausschuss einen für damalige Zeiten sehr weitsichtigen Beschluss zur Führung einer Fortbildungsschule:
„Zum Besuch der Fortbildungsschule, 3 bis 4 Stunden in der Woche, sind alle ausgeschulten Jünglinge bis zum vollendeten 17. Lebensjahr verpflichtet und haben dem Herrn Schulleiter Fidel Schallert in allen Stücken gehorsam zu leisten.“
Später wurde die Schule als Sonntagsschule geführt. Der Besuch war auch für Mädchen verpflichtend. Anfang der 1930er Jahre wurde die Sonntagsschule wieder aufgelassen. Im Jahr 1937 beschloss der Gemeindeausschuss aufgrund einer Weisung der Landeshauptmannschaft Vorarlberg, die Fortbildungsschule für die Jahrgänge 1919 bis einschließlich 1923 wieder einzuführen.
Seit Bestehen der Volksschule ist an der Erhaltung des Gebäudes und an der Inneneinrichtung nur wenig geschehen. Während des Zweiten Weltkrieges wurden überhaupt keine Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Gemeinde hatte weder Geld noch Zeit dafür. Das Schulgebäude samt Inventar befand sich in einem desolaten Zustand. Als nach Kriegsende französisches Militär Brand besetzte, bestellte dieses einen kommissarischen Bürgermeister und Gemeindeausschuss. Bereits in der ersten Sitzung am 20. Mai 1945 wies der Ausschuss auf die Missstände in der Schule hin und fasste folgenden Beschluss:
„Das Schulhaus, welches sich in kolossaler Unordnung befindet, soll von Hitler- Anhängern gereinigt werden.“
Nachdem sich für diese Arbeiten kein einziger Hitler- Anhänger finden ließ, wurde der Ausschuss nochmals aktiv und beschloss im Jänner 1946:
„In Anbetracht, dass sich die Abortanlage im Schulhaus, besonders im Parterre, in einem gesundheitswidrigen Zustand befindet, wird beschlossen, bis zur gegebenen Zeit diese Frage bestmöglich zu erledigen und dies dem Franz Josef Schedler zu übergeben. Wegen der Dringlichkeit des Ersatzes der Schulbänke wurde vorerst vereinbart, Holzscheine zu beschaffen, dann Holz zu liefern und neue Schulbänke zu bestellen.“
Als ich im Herbst 1946 als Erstklässler einschulte, saß ich jedenfalls auf einer neuen Schulbank und das „Plumpsklosett“ konnte anstandslos, jedoch mit kleinem Beigeschmack benützt werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte in der Volksschule wieder normaler Alltag ein. Auch die Fortbildungsschule wurde weitergeführt, der Unterricht aber auf zwei Jahre verlängert. Dieser fand von November bis April statt. Die Schule erhielt aber einen neuen Namen. Für die männlichen Volksschulabgänger wurde sie in landwirtschaftliche Fortbildungsschule und für die Mädchen in Haushaltungsschule umbenannt. Die Burschen wurden wöchentlich an zwei Abenden unterrichtet und die Mädchen wöchentlich an zwei Nachmittagen. […]
Nach dem Krieg begann wieder frisches Leben zu pulsieren und der Tourismus erlebte einen nicht geahnten Aufschwung. Neben vielen Gästen aus Deutschland verbrachten auch Engländer und Franzosen ihren Urlaub in unserem Dorf. Schon damals erkannten die Fremdenverkehrsinteressierten von Brand, wie wichtig es ist, eine Fremdsprache zu erlernen. Es war geradezu ein Glücksfall, dass zu dieser Zeit die Grafenfamilie Schönborn hier wohnte. […] Sie flüchtete am Ende des Krieges vor den Russen von Hollabrunn in Niederösterreich nach Brand. Die Familie beschäftigte für ihre Kinder standesgemäß eine Privatlehrerin. Diese unterrichtete deren fünf Sprösslinge in den Fremdsprachen Englisch und Französisch. Frau Kleteschka, die von den Brandnern liebevoll „Missi“ gerufen wurde, konnte als Lehrerin für die Fortbildungs- und Haushaltungsschule gewonnen werden. Sie brachte den Schülern die Grundbegriffe der englischen und französischen Sprache bei. Urlaubsgäste aus England und Frankreich waren dann nicht wenig überrascht, wenn ihnen junge Einheimische, zwar etwas holprig, in Englisch und Französisch antworteten.
Ab den 1950er Jahren besuchten immer mehr Brandner eine höherbildende Schule. Die Schülerzahlen in der Fortbildungsschule gingen stark zurück. Um den Bestand doch zu sichern, wurde die Fortbildungsschule von Brand mit der in Bürserberg zusammengelegt. Dort fand auch der gemeinsame Unterricht statt. Leo Gaßner erzählte mir, dass er als einziger Bub des Jahrgangs 1945 auch einziger Schüler von Brand in der Fortbildungsschule gewesen sei. Da auch in Bürserberg die Schülerzahlen stark zurückgegangen sind, wurde im Jahre 1959 der Schulbetrieb endgültig eingestellt.
Für die Brandner Volksschüler begann seit Bestehen der Schule bis in die 1980er Jahre jeder Schultag mit einer heiligen Messe. Diese fand täglich um 7:15 Uhr statt. Es galt nicht nur Anwesenheitspflicht für alle Schüler, sondern auch Aufsichtspflicht für den jeweiligen Lehrer. Pfarrer Anton Dönz, von 1893 bis 1900 Seelsorger in Brand, machte in seiner Chronik zur Schulmesse folgende Anmerkung:
„Die Werktagsschüler, Sommer- und Winterschüler müssen immer vorne in die Stühle und zwar sonntags und werktags. Auf den gegenwärtigen Lehrer Wendelin Jenny von Fontanella darf man sich nicht verlassen. Er mag zwar für seine Person ein recht guter Christ sein, aber seine Aufsicht in der Kirche lässt sehr zu wünschen übrig. Namentlich ist zu bedauern, dass er nicht laut betet.“
Als Anfang August 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, ist auch unser Dorf nicht verschont geblieben. Bereits zu Kriegsbeginn wurden zwanzig wehrtüchtige Brandner an die Front gerufen. Am Tag des Abschieds feierte Pfarrer Thomas Küng mit den jungen Männern eine heilige Messe und übergab ihnen nach einer aufmunternden Rede eine Muttergottesmedaille mit in den Krieg. Im Juli 1916 flatterte auch dem damaligen Brandner Schulleiter Fidel Schallert der Einrückungsbefehl ins Haus. Trotz größter Bemühungen des Gemeindevorstehers konnte für ihn kein Ersatzlehrer gefunden werden. Kurzfristig sprang „z’Odams Leo“ mit seinen erst 24 Jahren als Hilfslehrer ein. Er besaß zwar keinerlei pädagogische Ausbildung, war aber ein sehr gescheiter Bauernbub. Zudem besaß er einen gesunden Hausverstand, den man heute oft vermisst.
Im Herbst 1916 schulte mein Vater Othmar als Erstklässler in der Volksschule Brand ein. Leo Beck war sein Cousin und gleichzeitig sein erster Lehrer. Der Unterricht fand sehr eingeschränkt statt und das nur von Anfang November bis Ende Mai. In der übrigen Zeit vom Frühjahr bis Herbst wurden die Kinder bei der Feld- und Stallarbeit gebraucht, denn alle wehrtüchtigen Familienväter und Söhne hielten sich an der Kriegsfront auf. Als 1918 der Krieg zu Ende ging, kehrte Fidel Schallert als Schulleiter wieder an die Volksschule Brand zurück. Der Gemeindeausschuss beschloss darauf, ihm von Oktober bis Mai eine Lehrerin beizustellen, um einen zweiklassigen Schulbetrieb sicherzustellen. Ab dieser Zeit fand wieder normaler Unterricht mit zwei Klassen statt.
In früheren Jahren wurden die Volksschüler neben dem Schulunterricht auch zu verschiedenen anderen Arbeiten herangezogen. An kalten Wintertagen war es selbstverständlich, dass die Schüler Brennholz mitbringen mussten, um für eine warme Schulstube zu sorgen. Ein weiteres Beispiel ist aus der Zeit während des Ersten Weltkrieges bemerkenswert. Nachdem Baumwolle knapp war, sind als Ersatz verstärkt Brennnesseln für die Stofferzeugung verwendet worden. In den Schulen fanden die sogenannten „Nesseltage“ statt. Mädchen und Buben mussten unter Aufsicht des Schulleiters Fidel Schallert Brennnesseln sammeln. Diese wurden zu Stoffen verarbeitet und daraus Militäruniformen angefertigt. Als im Jahr 1919 das Kapuzinerkloster Bludenz bei der Gemeinde anfragte, ob es nicht möglich wäre, dem Kloster etwas Brennholz zu liefern, beschloss der Gemeindeausschuss:

Foto: Archiv Manfred Beck
„Die Gemeinde trägt das Ansuchen in der Weise mit, dass die Schulknaben eine Sammlung für diesen Zweck vornehmen dürfen und soll diese dann dem Kloster überbracht werden.“
Ein weiteres Beispiel für die Mitarbeit der Volksschüler in unterschiedlichen Bereichen war der Neubau der Volksschule im Jahre 1949. Bei der Ermittlung der Baukosten plante die Gemeinde von vornherein mit ein, dass verschiedene Arbeiten Brandner Bürger im Frondienst, aber auch die Schulkinder zu erbringen haben. Wir Schüler wurden u. a. zum Dachdecken eingeteilt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir Buben auf einer Leiter standen und die Dachziegel von Hand zu Hand aufs Dach beförderten. Nachdem wir diese Arbeit mit Bravour bewältigten, wurden wir Schüler dazu eingeteilt, auch bei der Dacheindeckung des Personalhauses vom Hotel Schesaplana mitzuhelfen. Als Belohnung wurden wir zu Würstchen und einer Limo eingeladen. Diese Tätigkeiten galten dann als Turnunterricht! Heute wäre dies unvorstellbar und der Bürgermeister wie auch der Lehrer würden vor dem Kadi landen!
Ich ging auch der Frage nach, inwieweit sich der Nationalsozialismus auf den Schulunterricht auswirkte. Wie bereits erwähnt, fand während des Zweiten Weltkrieges normaler Schulunterricht statt, der Einzug des NS-Gedankenguts war aber zu spüren. […] Ernst Bitschi erzählte mir, er erinnere sich noch gut, als ein NSDAP-Mann aus Bürs in die Schule gekommen sei. Die Buben mussten mit ihm ins Gufer gehen, um dort mit Stöcken aus Haselnuss das „Kriegsspielen“ zu lernen. Dabei habe er ihnen immer wieder eingetrichtert:
„Das Kämpfen für den Führer muss für euch Buben eine Ehre sein.“
Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei!
Während des Zweiten Weltkrieges war es Aufgabe der Schüler, die Mittagsglocken zu läuten. Damals gab es natürlich noch keinen mechanischen Antrieb. So wurden die Kirchenglocken bis zum Jahr 1953 mit einem langen Hanfseil händisch geläutet. Auch die Turmuhr musste von Hand aufgezogen werden, die Umstellung auf elektrisch wurde erst 1964 mit dem Umbau der Kirche installiert. Erich Schallert erzählte mir, dass „z’Joklis Buaba“ von der Gemeinde den Auftrag hatten, zu den vorgesehenen Zeiten die Glocken zu läuten und die Turmuhr aufzuziehen. Die jungen wehrtüchtigen Männer mussten aber in den Krieg einrücken. Während dieser Zeit sprangen die Volksschüler ein. Er und Helmut Gassner seien öfters zum 11-Uhr-Läuten und zum Aufziehen der Uhr eingeteilt worden. Sie hätten aber immer länger als bisher üblich geläutet, denn das Läuten habe ihnen mehr Spaß als der Schulunterricht gemacht.
Gerne erinnere ich mich an meine Volksschulzeit zurück. Bereits um 7:15 Uhr begann die Schulmesse. Da wir pünktlich sein mussten und von der Warth bis zur Schule gut eine halbe Stunde unterwegs waren, gingen wir sehr zeitlich weg. Im Frühjahr schien bereits die Sonne, im Winter war es noch stockdunkel. Oft stapften wir durch den tiefen Schnee und mussten uns selbst einen Weg bahnen, denn ein Schneepflug wie heute fuhr damals nicht. Ich staune heute noch, wie wir den langen Weg zur Schule, oft viermal am Tag, bewältigt haben. Für die Kinder von heute wäre dies unzumutbar!
Die damalige Erziehung der Kinder war sehr vom katholischen Glauben geprägt. Es galt für uns Schüler als selbstverständlich, ja, es war sogar Pflicht, monatlich zu beichten und wöchentlich einmal die heilige Kommunion zu empfangen. „Wer monatlich beichtet und kommuniziert, kommt in den Himmel“, hieß es. An Sonn- und Feiertagen besuchten wir um 9 Uhr das Hochamt mit vorhergehendem Rosenkranz und nach dem Mittagessen meinten die Eltern: „Es ischt Zit, i Vesper z’gôh.“ Diese fand nachmittags um zwei Uhr statt.
Zur Schülerbeichte wurde mir eine amüsante Begegnung erzählt, die sich Anfang der 1960er Jahre zugetragen hat. Die Brüder Wilfried und Peter Kegele vom Innertal gingen zur monatlichen Beichte. Befreit von allen „schweren Sünden und Lasten“ verließen sie den Beichtstuhl. Auf dem Heimweg sollen sie – wie es bei Buben hin und wieder vorkommt – mit anderen Schülern gestritten haben. Zu Hause angelangt, erzählten sie davon ihrer Mutter Luise. Diese war darüber so erschüttert, dass sie zu den zwei Buben sagte:
„Es därf doch net wôhr si, kaum hond’r biichtat und scho tuand’r wied’r sündiga. Jetzt gond’r noch amôl ussi und tuand des biichta, mit eura Sünd künd’r Marn doch net ge kommuniziara go.“
Die beiden Buben nahmen die „Moralpredigt“ ihrer Mama sehr zu Herzen und liefen eiligst zur Kirche. Dort saß zum Glück noch der Beichtvater im Beichtstuhl, es war Pater Mathias vom Bludenzer Kapuzinerkloster. Die beiden Buben baten – wohlgemerkt am selben Tag – ein zweites Mal um Vergebung ihrer Sünden. […]
Im Herbst 1946 schulte ich als Erstklässler in der zweiklassigen Volksschule von Brand ein. Die Schulkleidung war einfach, aber ordentlich. Meine Mama legte ja besonderen Wert „uf schös Hääs“. Ich trug eine kurze Lederhose mit Hosenträgern. Diese war für mich sehr praktisch, denn ich konnte auf dem Hintern den Warth-Bühel hinunterrutschen. Sie ging dabei nicht kaputt und wies lediglich Schleifspuren auf. Schuhe waren ein Luxus, den sich kaum jemand leisten konnte. So ging ich von Anfang Mai bis Oktober barfuß in die Schule. Ich lief über Stock und Stein und hatte Fußsohlen wie Leder. Schuhwerk zog ich erst wieder an, wenn der Boden gefroren und mit Reif bedeckt war. Die Schuhe waren aber nicht neu, ich erbte sie von meinem älteren Bruder Heinz und gab sie dann an meinen jüngeren Bruder Gerhard weiter. Auch er hätte gerne einmal Neue getragen, aber man musste ja sparen.

Wenn ich zur Schule ging, trug ich eine hölzerne Schultasche am Rücken, die sogenannte Bulga. An dieser baumelte ein Schwamm. Der Inhalt der Schultasche bestand aus einer Schiefertafel und einem Griffel. Diesen legte ich in einen Griffelkasten, da er leicht zerbrechlich war. Den Schwamm verwendete ich zum Ausbessern von Fehlern oder wenn die Tafel vollgeschrieben war. Schulbücher, ein Heft, eine Füllfeder oder gar einen Kugelschreiber wie heute kannte ich nicht. Diese Behelfe wurden erst Anfang der 1950er Jahre eingeführt.
Meine erste Lehrerin war Maria Hildebrand, eine liebe und, wie ich damals schon feststellte, eine fesche Tirolerin. Sie bemühte sich fürsorglich um uns Kinder und wollte nur das Beste aus uns machen. Schon damals lag mir unsere Mundart näher als das Schriftdeutsch und so sprach ich im Unterricht einfach im Dialekt. Unvergessen bleibt mir, als die Lehrerin zu mir sagte:
„Wenn du einmal älter bist, musst du auf Ämtern schon Hochdeutsch sprechen, sonst versteht dich ja niemand“
worauf ich antwortete:
„Desweg verschtond se mi oh.“
Offensichtlich war ich damals schon ein Fan unserer Mundart und zog diese dem Hochdeutschen vor. Die Volksschulzeit war nicht nur eine Zeit des Lernens, sondern auch des Spielens. In der Freizeit unternahmen wir Schüler die verschiedensten Spiele. Eine gesunde Rivalität bestand immer zwischen den „Innerbächlern“ und den „Außerbächlern“. […]
Auszug aus dem Buch von Manfred Beck:
Stubarte – Kirchabänk – Lotterläba.
Brandner erzählen. Seiten 26 – 33.
Gemeinde Brand (Hsg.) 2018.
Jodok Müller, Riezlern