
Bürgermeister
und Ortsvertreter der VWV
Mag. Erich Kaufmann
Kontakt:
Blons 9
6723 Blons
☎ +43 664 8449366
📧 buergermeister@blons.at

Mag. Erich Kaufmann
Blons 9
6723 Blons
☎ +43 664 8449366
📧 buergermeister@blons.at

Klaus Bitschi
Gufer 81
☎ +43 5559 30816
📧 klaus.bitschi@brand.at
Das Gemeindewappen stellt einen in rotem Schrägflammenschnitt geteilten silbernen Schild dar. Es spielt an die Herkunft des Ortsnamens Brand von „brennen“ an und soll an die Rodungsarbeit durch die ersten Walser erinnern. Dem steht allerdings auch eine andere Auslegung gegenüber, wonach der Name vom rätoromanischen „pratu grande“ abgeleitet sei, was große Wiese bedeutet.

Fridolin Plaickner
Boden1
6707 Bürserberg
☎ +43 5552 62708
📧 buergermeister@buerserberg.at

Stefan Bischof
Kirchdorf 136
6884 Damüls
☎ +43 5510 621 12
📧 buergermeister@damuels.at

Walter Rauch
Montanast 22
6822 Dünserberg
☎ +43 5524 2411 11
📧 gemeinde@duenserberg.at
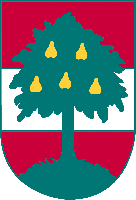
Markus Fäßler
Rathausplatz 2
6850 Dornbirn
☎ +43 5572 306 1000
📧 buergermeisterin@dornbirn.at
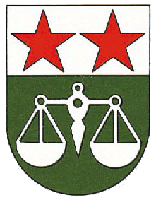
Werner Konzett
Kirchberg 25
6733 Fontanella
☎ +43 5554 521511
📧 bgm@gemeinde.fontanella.at
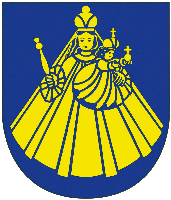
Hermann Huber
Galtür 39
6563 Galtür
☎ +43 5443 8210
📧 gemeinde@galtuer.gv.at
Stefan Lorenz
Galtür 93c/1
6563 Galtür
☎ +43 680 2456077
📧 stefan@vorarlberger-walservereinigung.at
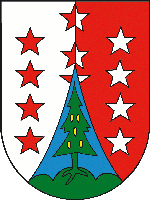
Gerold Welte
Laternserstraße 6
6830 Laterns
☎ +43 5526 212
📧 buergermeister@laternsertal.at
Cilly Nesensohn
Grabenstallstr. 8
A-6830 Laterns
☎ +43 650 752 7020
📧 cilly.nesensohn@gmail.com

Im Laternsertal herrschte wahrscheinlich, bevor die Walser kamen, reger Sommerbetrieb. Romanen waren es, die hier ein Leben als Holzarbeiter, Jäger oder Alphirten führten. Noch heute erhaltene rätoromanische Flurnamen zeugen davon. Rätoromanisch ist auch der Name Laternsertal selbst, wie auch Damüls, Fontanella, Raggal, Marul oder Galtür. Als Mons Clauturni taucht der Name erstmals 1177 auf. Viele Jahrhunderte hieß das Tal Glatterns, woraus schließlich der heutige Name Laterns wurde.
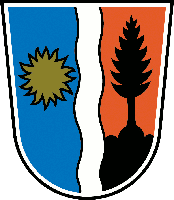
Gerhard Lucian
Dorf 329
6764 Lech
☎ +43 558 32213
📧 info@gemeinde.lech.at
Ludwig Muxel
Omesberg 210
A-6764 Lech
☎ +43 664 2003166
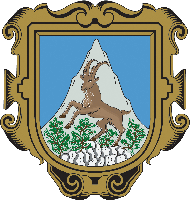
Joachim Fritz
Walserstraße 52
6991 Riezlern
☎ +43 5517 5315 240
📧 verwaltung@gde-mittelberg.at

Stephan Schwarzmann
Heimboden 2
6888 Schröcken
☎ +43 551 926719
📧 s.schwarzmann@warth-schroecken.com
Martin Bischof
Unterboden 92
6888 Schröcken
📧 martin.bischof@blum.com
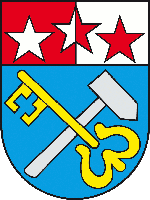
Thomas Zudrell
Dorfstraße 8
6782 Silbertal
☎ +43 5556 74104 2
📧 thomas.zudrell@silbertal.at
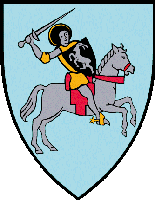
Stefan Nigsch
Boden 57
6731 Sonntag
☎ +43 664 2869078
📧 buergermeister@sonntag.info
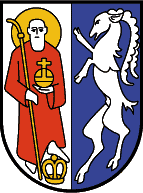
Alwin Müller
Faschinastraße 67
6722 St. Gerold
☎ +43 5550 2134
David Ganahl
Biraloch 33
6721 St. Gerold 63
☎ +43 5553 8102550
📧 david.ganahl@st-gerold.net
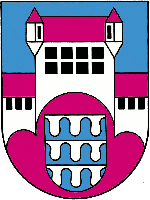
Ing. Wilhelm Müller
Jagdbergstraße 270
6721 Thüringerberg
☎ +43 5550 241712
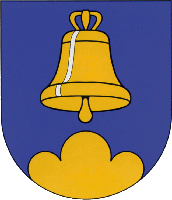
Christoph Beck
Landstraße 4
9497 Triesenberg
☎ +42 3 265 50 24
📧 christoph.beck@triesenberg.li
Hubert Sele
Rotenbodenstrasse 160
LI 9497 Triesenberg
📧 hubert.sele@adon.li